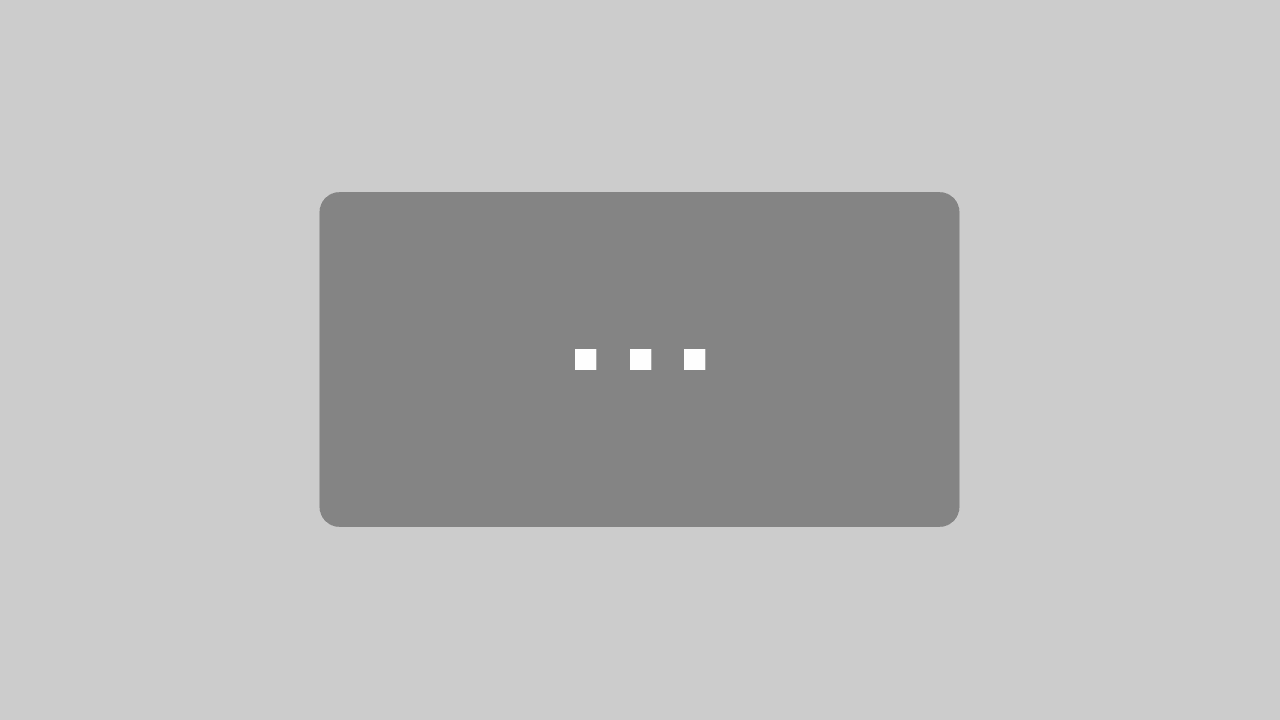Das Online-Glossar des Evidenzbasierten Informationszentrums für Pflegende informiert über relevante Fachbegriffe der evidenzbasierten Pflege und Medizin sowie der klinischen Epidemiologie (zur Verfügung gestellt mit freundlicher Unterstützung des Deutschen Cochrane Zentrums).
Wichtige Kennzahlen, die immer wieder in unseren Rapid Reviews verwendet werden, erklären wir in diesem Video:
Alle Quellen zu unserem Glossar finden Sie hier: Quellen-Glossar
Absolute Risikoreduktion
Absolute Risikoreduktion (ARR; absolute Risk Reduction/Difference) Effektmaß für dichotome Endpunkte; beschreibt die Differenz zwischen den Ereignisraten in der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe. Sie kann auf vier verschiedene Arten ausgedrückt werden, je nachdem, was gemessen wurde – eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für den Pflegebedürftigen –und ob die Ereignisraten in den beiden Gruppen gestiegen oder gesunken sind. Wenn zum Beispiel in der Kontrollgruppe einer Studie 30 von 100 Personen gestürzt sind, beträgt das Risiko 30 von 100 oder 0,30. Wenn in der Interventionsgruppe 20 von 100 Personen gestürzt sind, liegt das Risiko bei 0,20. Die absolute Risiko Risikoreduktion beträgt 0,3-0,20 = 0,1. Die Häufigkeit von Stürze konnte in der Interventionsgruppe also um 10 % gesenkt werden. (1)
Adjustierung
Adjustierung ein Verfahren, um den Einfluss des Risk of Bias in einer Analyse zu minimieren. Hierzu können unterschiedliche Methoden angewendet werden z. B. Stratifizierung, Regressionsanalyse oder Matching.(2)
Arithmetischer Mittelwert
Arithmetischer Mittelwert (MW; mean) eine neben dem Modus und dem Median zentrale Lagekenngröße für metrische Daten, die umgangssprachlich mit „Durchschnitt“ bezeichnet wird. Der arithmetische Mittelwert berechnet sich aus der Summe der Messwerte, dividiert durch die Anzahl der Messwerte. (3)
Ausfallrate
Ausfallrate (Drop-out-Rate) bezeichnet den Verlust an Studienteilnehmer*innen, die die Therapie nicht befolgen, die Gruppe wechseln und eine alternative Intervention erhalten, die Studie abbrechen oder der Nachbeobachtung verloren gehen. Siehe auch Intention-to-Treat-Analyse und Sensitivitätsanalyse. (4)
Beobachtungsstudien
Beobachtungsstudien (observational studies) Da der Begriff „Beobachtung“ auf verschiedenste Weisen in Verwendung ist, wird vom Gebrauch des Begriffs abgeraten und eher den Terminus „Nicht randomisierte Interventionsstudien“ zu verwenden. (2)
Best-fit Framework Synthese
Best-fit Framework Synthese (Best-fit Framework synthesis) ist eine Methode zur Synthese qualitativer Daten. Dabei wird eine ausgewählte, angepasste Theorie oder ein Rahmen oder ein Modell verwendet, um die Datenextraktion, die Analyse und die Interpretation der Ergebnisse der Primärforschung zu leiten (siehe Framework Synthese). (5)
CERQual
CERQual (Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative Research) CERQual bietet eine transparente Methode zur Bewertung des Vertrauens in die Ergebnisse qualitativer Evidenzsynthesen (QES) und zur Angabe dieses Vertrauens für Nutzer*innen, wie Leitlinienersteller*innen, Entscheidungsträger*innen etc. Die Bewertung des Vertrauens in die einzelne Syntheseergebnisse basiert auf der Berücksichtigung von vier Komponenten: methodische Einschränkungen, Kohärenz, Angemessenheit der Daten und Relevanz und drückt aus, inwieweit ein Syntheseergebnis das interessierende Phänomen angemessen darstellt. Sind die zum Ergebnis beitragenden Primärstudien adäquat konzipiert und durchgeführt, bestehen keine methodischen Einschränkungen. Das Ergebnis einer QES ist konsistent, wenn es die Daten aus den Primärstudien klar und schlüssig wiedergibt. Angemessenheit bezieht sich auf die Reichhaltigkeit und Quantität der Daten, die zum Ergebnis beitragen. Die Komponente Relevanz gibt an, inwieweit die Daten aus den Primärstudien, die das Ergebnis stützen, auf den in der QES angegebenen Kontext (Perspektive, interessierendes Phänomen, Umfeld) anwendbar sind. (6)
Cross-over-Design
Cross-over-Design ist ein Studiendesign, in dem die zu vergleichenden Interventionen in den Vergleichsgruppen in zeitlicher Folge angewandt werden. Dabei erhält z.B. die eine Gruppe zunächst Therapie A, dann Therapie B, die andere Gruppe zuerst Therapie B und dann Therapie A. (7)
Datenbanken
Datenbanken sind strukturierte Sammlungen von Informationen oder Daten. Im Kontext von Gesundheitswissenschaften wird häufig zwischen Volldatenbanken, datenbankspezifischen Suchmaschinen, Meta-Suchmaschinen und unspezifischen Suchmaschinen unterschieden. Weitere Informationen dazu können z. B. auf der Website zu finden sein. (8)
Dichotome Endpunkte
Dichotome Endpunkte sind Endpunkte, die auf diskreten Variablen basieren, die zwei mögliche Ausprägungen annehmen können (z. B. krank/nicht krank). Sie werden oft durch Maße wie das relative Risiko (RR) oder die Odds Ratio (OR) berechnet. (9)
Dokumentenanalysen, Textanalyse
Dokumentenanalysen, Textanalyse (content analysis) ist eine Methode, um manifestes Material, das nicht eigens zu Forschungszwecken geschaffen wurde, wissenschaftlich auszuwerten. Synonym wird auch der Begriff Inhaltsanalyse verwendet, jedoch steht Inhaltsanalyse auch für die Auswertung von Material aus der qualitativen Forschung, das eigens zu Forschungszwecken produziert worden ist, z.B. für Interviewtranskripte. Für die Pflegeforschung sind hier vor allem Pflegedokumentationen interessant, aber auch Lehrbücher, Tagebücher von Patient*innen, historische Dokumente, Schulprospekte, Fachzeitschriften oder Druckwerke wie Tageszeitschriften, Wochenschriften o.Ä. Dokumentenanalysen können sowohl qualitativ (offen) als auch quantitativ (standardisiert) erfolgen. (3)
Endpunkt
Endpunkt (outcome) ist das im Rahmen einer klinischen Studie erhobene Ergebnis (Outcome) für die Patient*innen im Verlauf der Studie. Oft werden in einer Studie verschiedene Endpunkte erhoben. Zumeist handelt es sich bei Endpunkten um Ereignisse, die eingetreten oder nicht eingetreten sind (zum Beispiel Herzinfarkte oder Tod) oder Ergebnisse auf einer kontinuierlichen Werteskale (zum Beispiel Höhe des Blutdrucks).(10)
Ethnografie
Ethnografie (ethnography) bezeichnet eine spezielle Form der qualitativen Forschung, deren zentrales Anliegen es ist, die Lebenswelt anderer Menschen aus deren Sichtweise zu verstehen (emisch) und das Spezifische, (Kultur-)Typische, das diese Lebenswelt ausmacht, zu erkennen. Ziel ist die Beschreibung fremder (Sub-)Kulturen, kultureller Gruppen oder Lebenswelten ebenso wie die Beschreibung der Verhaltensmuster einzelner Menschen oder Gruppen innerhalb einer Kultur, wobei der Begriff Kultur hier im Sinne von fremder Lebenswelt gemeint ist . (3)
Evidenzbasierte Pflege
Evidenzbasierte Pflege (EBN; Evidence based Nursing) ist die Integration der derzeit besten wissenschaftlichen Belege in die tägliche Pflegepraxis unter Einbezug theoretischen Wissens und der Erfahrungen der Pflegenden, der Vorstellungen des Patient*innen und der vorhandenen Ressourcen. (11)
Evidenzsynthese
Evidenzsynthese (evidence synthesis) kombinieren Informationen aus mehreren Studien, die sich mit demselben Thema befassen, um ihre Ergebnisse umfassend zu verstehen. Dies hilft bei der Bestimmung, wie wirksam eine bestimmte Behandlung oder ein bestimmtes Medikament ist oder wie Menschen eine bestimmte Krankheit oder Behandlung erlebt haben. Durch den effektiven Einsatz der Evidenzsynthese können politische Entscheidungsträger*innen, Gesundheitseinrichtungen, Kliniker*innen, Forscher*innen und die Öffentlichkeit fundiertere Entscheidungen über Gesundheit und Gesundheitsversorgung treffen. (12)
Fall-Kontroll-Studie
Fall-Kontroll-Studie (case-control study) beschreibt eine retrospektive Querschnittstudie mit Vergleichsgruppen: Fälle und Kontrollen. Zuerst wird die Fallgruppe aus Personen zusammengestellt, die das gesundheitsbezogene Ereignis/die Krankheit bzw. die zu erklärende Variable oder den Outcome aufweisen. Der Fallgruppe werden Personen ohne diese Variable als Kontrollen zugeordnet. Wichtig dabei ist, dass die Kontrollgruppe der Fallgruppe insofern gleicht, als die Kontrollen auch als Fälle hätten ausgewählt werden können, wenn sie die zu erklärende Variable gehabt hätten. (3)
Fallbericht
Fallbericht (case study) ist ein in Fachzeitschriften publizierter Bericht über eine einzelne Person. (2)
Fallserie
Fallserie (case series) ist ein in Fachzeitschriften publizierter Bericht über mehrere Personen. (2)
Fixed Effects Model
Fixed Effects Model (FEM) ist ein statistisches Modell zur Zusammenfassung von Ergebnissen einzelner Studien, wobei angenommen wird, dass alle Studien den gleichen Effekt schätzen und Unterschiede nur durch zufällige Abweichung bedingt sind. Somit ist die Ungenauigkeit des Gesamteffektes (pooled risk) nur durch die Variation innerhalb der einzelnen Studien beeinflusst. Beispiele sind die Inverse-Varianz-Methode, das Peto-Modell und die Mantel-Haenszel Odds Ratio. (2)
Forest Plots
Forest Plots finden in der Regel Anwendung bei der Visualisierung epidemiologischer Daten und werden in systematischen Übersichtsarbeiten eingesetzt, um bereits veröffentlichte Ergebnisse zusammenzufassen. Ein Forest Plot ist nicht notwendigerweise als metaanalytische Technik zu verstehen, sondern kann zur Darstellung der Ergebnisse einer Metaanalyse oder als Hilfsmittel verwendet werden, um aufzuzeigen, wo eine metaanalytische Auswertung sinnvoll sein könnte. (13)
Framework-Synthese
Framework-Synthese (framework synthesis) ist eine Methode zur Synthese qualitativer Daten. Dabei wird eine ausgewählte, angepasste oder selbst erstellte Theorie, ein Rahmen oder ein Modell verwendet, um die Datenextraktion, die Analyse und die Interpretation der Ergebnisse der Primärforschung zu leiten. Es gibt mehrere Varianten, darunter die „Best fit framework“ Synthese. (5)
Glaubwürdigkeit
Glaubwürdigkeit (credibility) ein Gütekriterium der qualitativen Forschung. Unter Glaubwürdigkeit versteht man die Korrektheit der Befunde aus der Sicht der Teilnehmer*innen und anderer Mitglieder der Disziplin. Dahinter verbirgt sich die Frage, ob die Forscher*innen richtig interpretiert haben, d.h. ob sie mit ihrer Interpretation das getroffen haben-, was die Teilnehmer*innen meinten. (3)
GRADE
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) wurde zur Evidenzbeurteilung und Entwicklung von Handlungsempfehlungen entwickelt. Es unterscheidet zwischen der Qualität der Evidenz und dem Grad der Empfehlungen für Handlungen im Gesundheitswesen. Folgende Domänen werden beurteilt: Risk of Bias, Inkonsistenz, Indirektheit, Ungenauigkeit und Publikationsbias. Bei der Beurteilung des Risk of Bias werden Limitationen, die den Behandlungseffekt verzerren können, bewertet. Durch die Bewertung der Inkonsistenz wird überprüft zu welchem Ausmaß Heterogenität aufgrund unterschiedlicher Effektmaße aus unbestimmten Gründen auftritt. Ergebnisse werden als ungenau eingestuft, wenn ein breites Konfidenzintervall vorliegt, wenige Personen und wenige Ereignisse festgestellt werden. Ein Publikationsbias liegt vor, wenn nur bestimmte, ausgewählte Studien in die Analyse miteinbezogen werden, was zu einer Verzerrung der Ergebnisse führt und das Vertrauen in die systematische Übersichtsarbeit somit beeinträchtigt. (6)
Graue Literatur
Graue Literatur (grey literature) ist die Bezeichnung für Dokumente, die häufig nicht über die Verlage publiziert und über den Buchhandel vertrieben werden, wie z.B. Amtliche Druckschriften, Fortschrittsberichte, Tagungsberichte, Kongressbeiträge, Reports, Publikationen von Formen, Verbänden, Institutionen etc. Sie werden häufig im Selbstdruck (Selbstvervielfältigung) durch Autor*innen oder Herausgeber*innen hergestellt. (14)
Grounded Theory
Grounded Theory (grounded theory) ist eine Methode der qualitativen Sozialforschung mit dem Ziel, erklärende Theorien für das menschliche Verhalten und für soziale Prozesse zu schaffen. Die Grounded Theory […] basiert auf der Theorie des symbolischen Interaktionismus. Die auf diese Weise geschaffenen Theorien werden direkt aus der Situation (dem Gegenstand) heraus entwickelt, d.h. sie sind in den Daten begründet („grounded“). Diese Methode kommt innerhalb der qualitativen Forschung hauptsächlich dann zum Einsatz, wenn man an menschlichen Interaktionen in sozialen Prozessen interessiert ist, an Veränderungen innerhalb eines Zeitraums, in dem eine soziale Lage gemeistert werden muss. Die Forschungsfragen sind daher meist aktions- oder veränderungsorientiert, z.B.: „Wie entsteht Vertrauen in der pflegerischen Beziehung?“. (3)
Handsuche
Handsuche (handsearching) beschreibt die Suche nach relevanter Literatur, die nicht in elektronischen Datenbanken enthalten ist. Insbesondere Durchsicht von Zeitschriften oder Abstractbänden, die nicht von z. B. Medline erfasst werden. (7)
Heterogenität
Heterogenität (heterogeneity) In systematischen Reviews oder Meta-Analysen bezeichnet Heterogenität, inwieweit die in den eingeschlossenen Studien gefundenen Effekte verschieden (heterogen) sind. Mit statistischen Heterogenitätstests kann festgestellt werden, ob die Unterschiede zwischen den Studien größer sind, als zufallsbedingt zu erwarten wäre. Als Ursachen für Heterogenität kommen Unterschiede in den Patient*innencharakteristika, Intervention oder Endpunkte zwischen den Studien in Frage, was aus klinischer Sicht beurteilt werden muss. Die Durchführung einer Meta-Analyse aus heterogenen Studien ist problematisch. (7)
Homogenität
Homogenität (homogeneity) In systematischen Reviews oder Meta-Analysen bezeichnet Homogenität, inwieweit die in den eingeschlossenen Studien gefundenen Effekte ähnlich (homogen) sind. (7)
Inhaltsanalyse
Inhaltsanalyse (content analysis) ist ein Überbegriff für Verfahren, die angewendet werden, um die Bedeutung von Texten, Bilder und anderen Formen fixierter, reproduzierbarer Kommunikation zu analysieren. Ziel einer Inhaltsanalyse ist nicht nur die reine Analyse des Inhalts, wie man aus der Bezeichnung „Inhaltsanalyse schließen könnte, sondern eine Analyse, die einen Schluss vom Material auf eine soziale Realität vollzieht. (3)
Interquartilabstand
Interquartilabstand (IQR; interquartilrange) bezeichnet den Bereich in dem die Hälfte aller Ereignisse/Endpunkte um den Median liegt, also alle Daten im Bereich von 25 bis 75 Prozent. (15)
Interventionsgruppe
Interventionsgruppe (intervention group) ist jene Gruppe von Personen, die in einer experimentellen Studie (Experiment) der experimentellen Interventionen ausgesetzt ist. (3)
Interview
Interview (interview) eine mündliche Befragung mit einem bestimmten (Forschungs-) Ziel. Ein Interview zeichnet sich durch planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung aus und zielt darauf ab, die Versuchungspersonen durch Fragen zu verbal mitgeteilten Informationen zu veranlassen. (3)
Inzidenz
Inzidenz (incidence) beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. (7)
Kategorie
Kategorie (category) ist ein abstrakter Begriff, der als Überbegriff für ähnliche Phänomene, die in Daten gefunden werden, formuliert wird. Bei der Verarbeitung werden die Daten kodiert (kodieren), die Kodes verglichen und in Kategorien geclustert, d.h. zusammengefasst; das Bilden von Kategorien ist das wichtigste Ziel bei der Auswertung qualitativer Daten. (3)
Klinische Relevanz
Klinische Relevanz (clinical relevance) bezieht sich auf die klinische Interpretation eines Endpunkts unter Verwendung eines Schwellenwerts. Siehe minimaler signifikanter Unterschied und minimaler klinisch signifikanter Unterschied. (1)
Klinische Studie
Klinische Studie (clinical study) ist ein unscharf definierter Begriff für eine Studie, in der eine Intervention an einer Gruppe von Patient*innen untersucht wird. Oberbegriff für unterschiedliche Studientypen, z. B. nicht kontrollierte, kontrollierte und randomisierte klinische Studien.(1)
Kodierung
Kodierung (coding) der Prozess des Umwandelns der inhaltlichen Informationen in eine Datenform zur Analyse und Interpretation des Materials. In der quantitativen Forschung werden dabei den Kategorien Zahlen zugeordnet. In der qualitativen Forschung ist das Kodieren der Prozess des Zuordnens bestimmter Aussagen, Beobachtungen etc. zu Kategorien. (3)
Kohorte
Kohorte (cohort) eine Gruppe von Menschen, die – für einen speziellen Zeitabschnitt – ähnliche Erfahrungen teilen; häufig eine Gruppe von Menschen, die im gleichen Zeitraum geboren wurden (Alterskohorte). (3)
Kohortenstudie
Kohortenstudie (cohort study) Vergleichende Beobachtungsstudie, in der Personen (Kohorte) mit bzw. ohne eine Intervention / Exposition (zu der sie nicht von dem Studienarzt zugeteilt wurden) über einen definierten Zeitraum beobachtet werden, um Unterschiede im Auftreten der Zielerkrankung festzustellen. Kohortenstudien können prospektiv oder retrospektiv durchgeführt werden. (7)
Konfidenzintervall
Konfidenzintervall (confidence intervall) Bereich, in dem der „wahre“ Wert einer Messung (Effektgröße) mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann (üblicherweise 95%-Konfidenzintervall). Die Effektgröße kann dabei z.B. ein Therapieeffekt, ein Risiko oder die Sensitivität eines diagnostischen Tests sein. Das Konfidenzintervall beschreibt die Unsicherheit über die Zuverlässigkeit der Aussage zur Effektgröße. Die Breite des Konfidenzintervalls (KI) hängt u.a. von der Zahl der in die Studie eingeschlossenen Patient*innen ab und wird mit zunehmender Patient*innenzahl enger, d. h. die Effektgröße kann präziser geschätzt werden. (7)
Kontinuierliche Variable
Kontinuierliche Variable (continuous variable) Im Gegensatz zu diskreten Variablen können kontinuierliche Variablen theoretisch eine unendlich große Zahl von Werten entlang eines Kontinuums annehmen. Körpergröße, Gewicht und viele Laborwerte sind kontinuierliche Variablen. (7)
Kontrollgruppe
Kontrollgruppe (control group) eine Gruppe von Personen in einer experimentellen Studie (Experiment), die die Standardbehandlung (Standardpflege, Standardbetreuung etc.) erhält, ohne einer Intervention ausgesetzt zu sein. (3)
Kredibilitätsintervall
Kredibilitätsintervall (credibility interval) ist das Bayessche Pendant zum klassischen Konfidenzintervall der Inferenzstatistik und bezeichnet den Bereich, in dem der wahre Wert einer Messung (Effektgröße) mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt. (16)
Längsschnittstudie
Längsschnittstudie (longitudinal study) ein Untersuchungsdesign, bei dem die Datenerhebung zu mindestens zwei verschiedenen Zeitpunkten erfolgt und jeweils mit denselben Methoden durchgeführt wird. (3)
Matching
Matching beschreibt einen Prozess, in dem vergleichbare Fälle für eine Studien- oder Fallgruppe gesucht werden. Der Einfluss ausgewählter externer Faktoren, z.B. Alter, Geschlecht oder Sozialindikatoren, soll dabei kontrolliert werden können, indem diese vergleichbar gemacht werden. (3)
Median
Median (median) ist der Wert in der Mitte aller gemessener Werte. Die Hälfte aller Werte liegt über und die andere Hälfte der Werte unter dem Median. (2)
MeSH-Term
MeSH-Term (Medical Subject Headings) ist ein weltweit verbreiteter, polyhierachischer, konzeptbasierter Thesaurus, also ein Schlagwortregister, für biomedizinische Fachbegriffe. MeSH umfasst das Vokabular, welches in MEDLINE/PubMed, dem NLM-Katalog und anderen NLM-Datenbanken erscheint. Er wird von der U.S. National Library of Medicine (NLM) herausgegeben, jährlich überarbeitet und um neue Begriffe erweitert. Er wird unter anderem verwendet zum Katalogisieren von Buch- und Medienbeständen, Indexieren von Datenbanken und Erstellen von Suchprofilen. (17)
Meta-Analyse
Meta-Analyse (meta-analysis) ist ein statistisches Verfahren, um die Ergebnisse mehrerer Studien, die die gleiche Frage bearbeiten, quantitativ zu einem Gesamtergebnis zusammenzufassen und dadurch die Aussagekraft (Genauigkeit der Effektschätzer) gegenüber Einzelstudien zu erhöhen. Meta-Analysen werden mit zunehmender Häufigkeit in systematischen Reviews eingesetzt. Allerdings beinhaltet nicht jeder systematische Review eine Meta-Analyse. (7)
Meta-Ethnographie
Meta-Ethnographie (meta-ethnography) ist eine theoriebildende Methode zur Synthese qualitativer Erkenntnisse (Daten), wobei die Synthese auf den Interpretationen, Konzepten oder Theorien beruht, die von den Autor*innen der Primärstudien entwickelt wurden (bekannt als „Konstrukte zweiter Ordnung“). (7)
Meta-Synthese
Meta-Synthese (meta-synthesis) ein Verfahren, bei dem Ergebnisse verschiedener qualitativer Untersuchungen zum selben Thema zusammengefasst werden. Mit einer Meta-Synthese sollen – über eine rein narrative Zusammenfassung mehrerer qualitativer Studien hinausgehend – die Ergebnisse der betreffenden Untersuchungen zu einer Theorie, einer großen Erzählung oder Interpretation integriert werden. (3)
Methodische Limitation
Methodische Limitation ist ein Begriff aus der qualitativen Forschung und bezeichnet das Gegenstück zum Verzerrungsrisiko (Risk of Bias) in quantitativen Studien. Er gibt an, inwieweit eine qualitative Studie angemessen konzipiert und durchgeführt wurde und ist das Ergebnis einer kritischen Beurteilung. Sorgfältig durchgeführte qualitative Studien weisen keine, minimale oder geringfügige methodische Limitationen auf. (18)
Minimaler bedeutsamer Unterschied
Minimaler bedeutsamer Unterschied (MID; minimal important difference) ist ein Schwellenwert, der eine bedeutsame Veränderung in Bezug auf einen Endpunkt angibt. Im Vergleich zum kleinsten klinisch bedeutsamen Unterschied (MCID) fehlt hier das Wort „klinisch“. Daher kann der kleinste bedeutsame Unterschied auch auf einer Änderung eines Labor- oder Funktionstests beruhen. (19)
Minimaler klinisch bedeutsamer Unterschied
Minimaler klinisch bedeutsamer Unterschied (MICD; minimum clinically important difference) ist ein vom Patient*innen ermittelter Schwellenwert, der eine für die Betroffenen bedeutsame Veränderung einer klinischen Intervention widerspiegelt. Derzeit gibt es keinen Standard für die Berechnung dieser Schwellenwerte und verschiedene Methoden zur Bestimmung des minimalen klinisch wichtigen Unterschieds, da es eine Reihe von Faktoren gibt, die diesen Wert beeinflussen können. Der Begriff des minimalen bedeutsamen Unterschieds (minimal important difference) ist davon zu unterscheiden, da beide Begriffe zwar ähnlich formuliert sind, jedoch zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. Siehe minimaler bedeutsamer Unterschied. (20)
Nachbeobachtung
Nachbeobachtung (follow-up) bezeichnet die Beobachtungsdauer einer Studie, während der das Auftreten von Ereignissen bei den Teilnehmer*innen registriert wird. (10)
Nicht randomisierte Interventionsstudien
Nicht randomisierte Interventionsstudien (NRSI; Non-Randomized Study of Intervention) erfassen Eigenschaften und Verhalten der Teilnehmer*innen sowie gesundheitliche Ereignisse, ohne aktiv in medizinische Maßnahmen einzugreifen. Sie dienen der Beschreibung von Krankheitsverläufen und Zusammenhängen zwischen Expositionsfaktoren und Ereignissen. Da Teilnehmer*innen mit bestimmten Merkmalen oft weitere Unterschiede aufweisen, können einzelne Faktoren schwer abgegrenzt werden. Dies macht nicht randomisierte Interventionsstudien anfällig für Verzerrungen wie Confounding oder Selektionsbias, wodurch sie Kausalzusammenhänge in der Regel nicht nachweisen können. (10)
Odds Ratio
Odds Ratio (OR) ist ein Effektmaß für dichotome Daten und bezeichnet das Verhältnis (Ratio) der Odds (Chancen), dass ein Ereignis oder Endpunkt in der experimentellen Gruppe eintritt, zu der Odds, dass das Ereignis in der Kontrollgruppe eintritt. Eine OR von 1 bedeutet, dass zwischen den Vergleichsgruppen kein Unterschied besteht. Bei ungünstigen Endpunkten zeigt eine OR < 1 an, dass die experimentelle Intervention wirksam ist, um die Odds für das Auftreten dieser ungünstigen Endpunkte zu senken. (7)
p-Wert
p-Wert (p-value) beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass der beobachtete (oder ein noch extremerer) Effekt einer Studie aufgetreten sein könnte, wenn die Nullhypothese richtig und der Effekt auf das Spiel des Zufalls zurückzuführen ist. Je kleiner der Wert, desto deutlicher spricht das beobachtete Ergebnis gegen die Nullhypothese. Es ist eine Konvention, dass ein p-Wert gleich oder kleiner 0.05 als statistisch signifikant angesehen wird. Wenn die Signifikanz von Effekten interpretiert wird, sollten p-Werte immer im Zusammenhang mit Konfidenzintervallen verwendet werden. (7)
Per Protocol Analyse
Per Protocol Analyse (per-protocol analysis) ist eine Analyse, bei die nur die Personen eingeschlossen werden, die protokollgemäß behandelt wurden. (2)
Phänomenologische Studie
Phänomenologische Studie (phenomenological study) untersucht die Komplexität menschlicher Erfahrungen und versucht diese aus einer ganzheitlichen Perspektive, wie diese gelebt werden, zu beschreiben. (9)
PIKO
PIKO (PICO) ist ein Hilfsschema für die Formulierung einer klinischen Frage zur Wirkung von Interventionen: Patient*in, Intervention, Kontrollintervention (Comparison), Zielgrösse (Outcome). (7)
Population
Population (population) beschreibt die Gesamtheit aller Personen oder Dinge, die ein bestimmtes gemeinsames Merkmal aufweisen, z.B. alle Pflegekräfte mit dreijähriger Ausbildung in Deutschland. (3)
Prädiktionsintervall
Prädiktionsintervall (prediction intervall) quantifiziert im Rahmen von Meta-Analysen mit zufälligen Effekten das Ausmaß der vorhandenen Heterogenität und gibt an, wie die tatsächliche Effektgröße (Endpunkt) in verschiedenen Populationen variiert und in welchem Bereich die wahre Effektgröße mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in allen vergleichbaren Populationen liegt. (10)
PRISMA Statement
PRISMA Statement (The Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) ist ein Leitfaden für die Berichterstattung von systematischen Übersichtsarbeiten quantitativer Studien. Der Leitfaden enthält eine Liste von Mindestinformationen, die notwendig sind, damit ein Manuskript von Leser*innen verstanden, von Forscher*innen reproduziert und von Kliniker*innen für klinische Entscheidungen genutzt werden kann. Er unterstützt damit die transparente Berichterstattung in systematischen Übersichtsarbeiten. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Tools entwickelt, wie z.B. die PRISMA 2020 Checkliste oder das PRISMA 2020 Flussdiagramm. (21)
Prospektive Studie
Prospektive Studie (prospective study) bezeichnet eine Untersuchung, bei der man im Zeitverlauf vorwärtsgerichtet nach einer Wirkung oder dem Auftreten einer Verhaltensweise sucht. (3)
Quasi-Randomisierung
Quasi-Randomisierung meint Methoden der Studienzuordnung, die zwar nicht randomisiert sind, jedoch mit der Absicht angewandt werden, bei der Teilnehmer*innenzuordnung ähnliche Gruppen zu gewährleisten. Beispiele: Zuordnung nach Geburtsdatum oder Krankenhausidentifikationsnummer, alternierende Zuordnung. (7)
Querschnittsstudie
Querschnittsstudie (cross-sectional study) ist ein Untersuchungsdesign (Forschungsdesign), bei dem die Daten einmalig – meist zu einem bestimmten Zeitpunkt – in einer Stichprobe gesammelt werden. (3)
Random Effects Model
Random Effects Model (REM) ist ein statistisches Modell zur Berechnung zusammengefasster (gepoolter) Ergebnisse, bei denen im Gegensatz zum Fixed Effects Modell Effektunterschiede zwischen verschiedenen Studien berücksichtigt werden. In die Genauigkeit der Schätzung des gemeinsamen Effekts geht daher nicht nur die Variation ein, die innerhalb der Studien beobachtet wird, sondern auch die Variation zwischen den Studien. Ein Beispiel ist die Methode nach DerSimonian & Laird. (7)
Randomisierte Studie
Randomisierte Studie (randomized trial) bezeichnet eine experimentelle Studie, bei der die Patient*innen nach einem Zufallsverfahren (mit verdeckter Zuordnung) auf die Therapie- bzw. die Kontrollgruppe verteilt (Randomisierung) und auf das Auftreten der festgelegten Endpunkte in den einzelnen Gruppen nachbeobachtet werden. (7)
Randomisierung
Randomisierung (randomization) beschreibt ein Verfahren, dass eine zufällige Verteilung der Patient*innen auf eine Therapie- und eine Kontrollgruppe bewirkt. Dies kann durch (computergenerierte) Zufallszahlen oder andere Mechanismen erreicht werden. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Teilnehmer*innen die gleiche Chance haben, der einen oder anderen Gruppe zugeordnet zu werden und es wahrscheinlich ist, dass sich (bei ausreichender Studiengröße) bekannte wie unbekannte Risiko- und Prognosefaktoren ausgeglichen auf die beiden Gruppen verteilen. Wenn sich zwischen den beiden Gruppen in den Endpunkten ein Unterschied zeigt, kann dieser tatsächlich der experimentellen Intervention zugeordnet werden. Die Randomisierung ist das entscheidende Instrument zur Verhinderung einer Selektionsbias und damit eines der wichtigsten Mittel zur Sicherung der internen Validität einer klinischen kontrollierten Studie. (7)
Rapid Review
Rapid Review ist eine Form der Evidenzsynthese, bei der Informationen aus verschiedenen Forschungsstudien gesammelt und zusammengefasst werden. Ziel ist es, auf systematische und ressourceneffiziente Weise Erkenntnisse für die Öffentlichkeit, Leistungserbringer*innen im Gesundheitswesen, Forscher*innen, politische Entscheidungsträger*innen und Geldgeber*innen zu gewinnen. Um dies zu erreichen, wird die Art und Weise, wie traditionelle strukturierte (systematische) Übersichtsarbeiten geplant und durchgeführt werden und/oder wie die Ergebnisse präsentiert werden, beschleunigt. Dies wird durch die Vereinfachung oder den Verzicht auf eine Vielzahl von Methoden erreicht, die von den Autor*innen klar definiert werden müssen. (22)
Relatives Risiko
Relatives Risiko (RR; risk ratio) beschreibt ein Effektmaß für dichotome Variablen. Das relative Risiko in einer Therapiestudie bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko in der experimentellen Gruppe und dem Risiko in der Kontrollgruppe. Ein relatives Risiko von 1 bedeutet, dass zwischen den Vergleichsgruppen kein Unterschied besteht. Bei ungünstigen Ereignissen zeigt ein RR < 1 , dass die experimentelle Intervention wirksam ist, um das Auftreten von ungünstigen Ereignissen zu senken. (7)
Retrospektive Studie
Retrospektive Studie (retrospective study) bezeichnet eine Untersuchung, bei der man zeitlich rückwärtsgerichtet nach einer Ursache oder einem Einfluss sucht. (3)
Risikofaktor
Risikofaktor (risk factor) beschreibt einen Faktor, der ein Risiko bei der Entstehung eines Gesundheitsproblems darstellen kann, z.B. ein bestimmtes Verhalten, der Lebensstil, die soziale Schicht, aber auch die Exposition gegenüber Umweltfaktoren oder angeborene oder ererbte Faktoren. Der Begriff Risiko sagt nicht aus, ob dieser Faktor auch eine Ursache darstellt (Kausalität). (3)
Selektionseffekt
Selektionseffekt (sampling bias) ist ein unerwünschter Einfluss auf die Ergebnisse einer Studie, der durch die Auswahl der Untersuchungsteilnehmer*innen entstehen kann. Wenn die Auswahl der Untersuchungsteilnehmer*innen nicht durch Randomisierung erfolgt, so können selektionsbedingte Einflüsse auf das Ergebnis in Kraft treten und damit die interne Validität gefährden. (3)
Sensitivität
Sensitivität (sensitivity) bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gesundheitsproblem anhand eines positiven Testbefundes als vorhanden erkannt wird. Die Sensitivität gibt den Anteil jener Personen an, an denen durch einen positiven Testbefund ein Gesundheitsproblem festgestellt wird, bezogen auf die Gesamtheit aller Personen, die dieses Gesundheitsproblem aufweisen. (3)
Sensitivitätsanalyse
Sensitivitätsanalyse (sensitivity analysis) wird als Wiederholung der ursprünglichen Analyse unter anderen Annahmen verstanden, um zu überprüfen, inwieweit sich dies auf die Ergebnisse auswirkt. Beispiele sind Änderungen der Einschlusskriterien oder Annahmen für fehlende Werte. (7)
Spannweite
Spannweite (range) definiert die Breite variierender Messwerte vom kleinsten bis zum größten Messwert. (1)
Spezifität
Spezifität (specifity) ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Nicht-Vorhandensein eines Gesundheitsproblems anhand eines negativen Testbefundes tatsächlich erkannt wird. Die Spezifität gibt den Anteil jener Personen an, an denen durch einen negativen Testbefund das Nicht-Vorhandensein eines Gesundheitsproblems festgestellt wird, bezogen auf die Gesamtheit aller Personen, die dieses Gesundheitsproblem nicht aufweisen. (3)
Standardabweichung
Standardabweichung (SD; standard deviation) wird als Maß für die Streuung von Messwerten um den Durchschnittswert definiert. (7)
Standardfehler
Standardfehler (SE; standard error) gibt an wie unterschiedlich zum Beispiel Mittelwerte von Stichproben aus einer Population bei einem bestimmten Stichprobenumfang ausfallen können. (15)
Standardisierte Mittelwertdifferenz
Standardisierte Mittelwertdifferenz (SMD; standardized mean difference) wird als Effektmaß für kontinuierliche Endpunkte, die mittels Skalen (z.B. Schmerzskala, Lebensqualität) gemessen werden, angegeben. In einer Metaanalyse können unterschiedliche Skalen, die denselben Endpunkt messen, gepoolt werden. Die Interpretation ist jedoch durch das Fehlen einer gemeinsamen Maßeinheit schwierig. (1)
Statistische Signifikanz
Statistische Signifikanz (statistical significance) besitzt ein Ergebnis einer Studie, das gegen die Nullhypothese spricht. Die Aussage basiert auf einem statistischen Test, der zur Prüfung einer vorab festgelegten Hypothese mit vorab festgelegter Irrtumswahrscheinlichkeit durchgeführt wird. Statistische Signifikanz darf nicht mit klinischer Relevanz gleichgesetzt werden. (7)
Stichprobe
Stichprobe (sample) bezeichnet eine Gruppe von Elementen, die Teile einer bestimmten Grundgesamtheit sind, z.B. alle Pflegepersonen mit dreijähriger Ausbildung in Deutschland. (3)
Stichprobenziehung
Stichprobenziehung (sampling) wird zur Auswahl von Primärstudien genutzt, die in einer qualitativen Evidenzsynthese verwendet werden, wenn eine große Anzahl relevanter Studien vorliegt und die Einbeziehung aller Studien die Qualität der Synthese beeinträchtigen könnte. Dabei wird eine Stichprobe aus den relevanten Studien unter Anwendung einer geeignete Stichprobenziehungsmethode gezogen. Mögliche Optionen sind z. B. das theoretische Sampling und die Methode der maximalen Variation. (23)
Studiendesign
Studiendesign (research design) ist die Untersuchungsanordnung, die das Vorgehen bei der Forschungsarbeit bestimmt. Der Terminus Design ist prinzipiell ein den konkreten Erhebungs- und Auswertungsmethoden übergeordneter Begriff. Ein Design kann nach unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet werden, je nachdem, was im Vordergrund steht. Zum Beispiel können Designs, bei denen unter kontrollierten Bedingungen Variablen verändert werden (Experiment), von Designs unterschieden werden, bei denen dies nicht der Fall ist (nichtexperimentelle Forschung). Man kann den Blickwinkel auch auf den Zeitpunkt der Datenerhebung oder auf den Zweck der Studie richten. (3)
Studienteilnehmer*Innen
Studienteilnehmer*Innen (study participtants) sind die Menschen, die an einer Untersuchung teilnehmen. (3)
Surrogatendpunkte
Surrogatendpunkte (surrogate outcomes) sind Endpunkte, die selbst nicht von unmittelbarer Bedeutung für die Patient*innen sind, aber stellvertretend für wichtige Endpunkte stehen können (z. B. Blutdruck als Risikofaktor für Schlaganfall). Surrogatendpunkte sind oft physiologische oder biochemische Marker, die relativ schnell und einfach gemessen werden können und denen eine Vorhersagefunktion für spätere Ereignisse zugemessen wird. Für viele Surrogatendpunkte ist eine zuverlässige Vorhersage auf ein späteres Ereignis nicht nachgewiesen. (7)
Systematische Literatursuche
Systematische Literatursuche ist ein strukturierter und vorab geplanter organisierter Suchprozess. Das bedingt eine sorgfältige Abwägung der Suchbegriffe, die Auswahl von Datenbanken, die Wahl der Suchmethoden und die Reflexion der während des Prozesses erzielten Suchergebnisse. Dadurch wird das Risiko für Diskrepanzen und Verzerrungen vermieden. (24)
Systematische Übersichtsarbeit
Systematische Übersichtsarbeit/Systematischer Review (SR; systematic review) zählt zur Sekundärforschung, bei der zu einer klar formulierten Frage alle verfügbaren Primärstudien systematisch und nach expliziten Methoden identifiziert, ausgewählt und kritisch bewertet und die Ergebnisse extrahiert und deskriptiv oder mit statistischen Methoden quantitativ (Meta-Analyse) zusammengefasst werden. Nicht jeder systematische Review führt zu einer Meta-Analyse. (7)
Systematischer Review
Systematische Übersichtsarbeit/Systematischer Review (SR; systematic review) zählt zur Sekundärforschung, bei der zu einer klar formulierten Frage alle verfügbaren Primärstudien systematisch und nach expliziten Methoden identifiziert, ausgewählt und kritisch bewertet und die Ergebnisse extrahiert und deskriptiv oder mit statistischen Methoden quantitativ (Meta-Analyse) zusammengefasst werden. Nicht jeder systematische Review führt zu einer Meta-Analyse. (7)
Thematische Synthese
Thematische Synthese (thematic synthesis) ist eine Methode zur Synthese von qualitativen Daten. Diese kombiniert Techniken der Meta-Ethnographie und der Grounded Theorie. Dabei werden Codes aus der Primärenstudien zu "deskriptiven" Themen organisiert, die dann weiter interpretiert werden, um "analytische" Themen zu erhalten. (25)
Triangulation
Triangulation (triangulation) meint die Kombination mehrerer Methoden innerhalb einer Untersuchung, um das gleiche Phänomen zu untersuchen. Man unterscheidet methodeninterne und methodenübergreifende Triangulation.
- Methodeninterne Triangulation: die Kombination von Verfahren aus ein und demselben Forschungsansatz, z.B. eine schriftliche Befragung und eine Dokumentenanalyse oder offene Interviews und teilnehmende Beobachtungen.
- Methodenübergreifende Triangulation, methodenexterne Triangulation: die Kombination von Verfahren aus dem quantitativen und dem qualitativen Ansatz. (3)
Übertragbarkeit
Übertragbarkeit beschreibt die Übertragbarkeit von Studienergebnissen auf die Patient*innen in der Routineversorgung, d.h. auf Patient*innen, die nicht an der Studie teilgenommen haben. (7)
Unterbrochene Zeitreihenanalyse
Unterbrochene Zeitreihenanalyse (interrupted time series analysis) ist eine Methode zur Messung der Wirkung einer Intervention, die verwendet wird, wenn eine Randomisierung oder die Bildung einer Kontrollgruppe nicht durchführbar ist. Mehrere Datenpunkte werden vor und nach der Intervention erhoben und die Wirkung der Intervention wird anhand des Trends vor der Intervention gemessen. (26)
Validität
Validität (validity) bezeichnet einerseits die interne Validität als Ausmaß, mit dem die Ergebnisse einer Studie den „wahren“ Effekt einer Intervention / der Exposition wiedergegeben werden, d.h. frei von systematischen Fehlern (Bias) sind. Die interne Validität beruht auf der Integrität des Studiendesigns und ist Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Studienergebnisse in der Routineversorgung. Des Weiteren beschreibt die externe Validität die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte. (7)
Variable
Variable (variable) ist eine Eigenschaft oder ein Merkmal einer Person, eines Objekts oder eines Konzepts, das Gegenstand der Untersuchung ist. Im Gegensatz zu einer Konstanten kann eine Variable unterschiedliche Werte oder Ausprägungen annehmen – sie variiert. Variablen können nach ihrer Funktion in der Untersuchung unterschieden werden: Abhängige Variable: Die Variable, von der man annimmt, dass ihre Ausprägung von der unabhängigen Variable abhängig oder durch sie verursacht ist. Sie wird auch als Ergebnis- oder Zielvariable bezeichnet; Unabhängige Variable: Dies ist die diejenige Variable, von der man annimmt, dass sie eine andere – nämlich die abhängige Variable – beeinflusst. Siehe auch dichotome Variable und diskrete Variable. (3)
Verzerrungsrisiko
Verzerrungsrisiko (RoB; Risk of Bias) ist in allen Stadien von Studien im Gesundheitswesen möglich und kann das Ausmaß und die Richtung der Ergebnisse beeinflussen. Es gibt eine Vielzahl an möglichen Verzerrungsmöglichkeiten. Eine Liste an möglichen Bias und deren Erklärungen finden Sie hier: https://catalogofbias.org/about/. (2)
Vorher-Nachher-Studie
Vorher-Nachher-Studie (before-after study) ist ein Studiendesign, in dem die Entscheidungen über die Zuweisung zu den Behandlungsgruppen (Vergleichsgruppen) nicht von Forscher*innen getroffen werden. Die Effektgröße wird an zwei verschiedenen Zeitpunkten gemessen in der Regel vor der Einführung einer Intervention/Maßnahme und erneut danach. (26)
Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit (probability) wird als das Verhältnis bestimmter Ereignisse zur Anzahl aller möglichen Ereignisse bezeichnet. Grundsätzlich geht man davon aus, dass jedes Ereignis die gleiche Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Diese Definition ist die Grundlage der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie, an der sich die Inferenzstatistik orientiert. (3)
Wirksamkeit
Wirksamkeit (effectiveness, efficacy) allgemein das Ausmaß, in dem sich eine Intervention, Prozedur, Dienstleistung oder sonstige Maßnahme auf definierte Populationen auswirkt. (3)